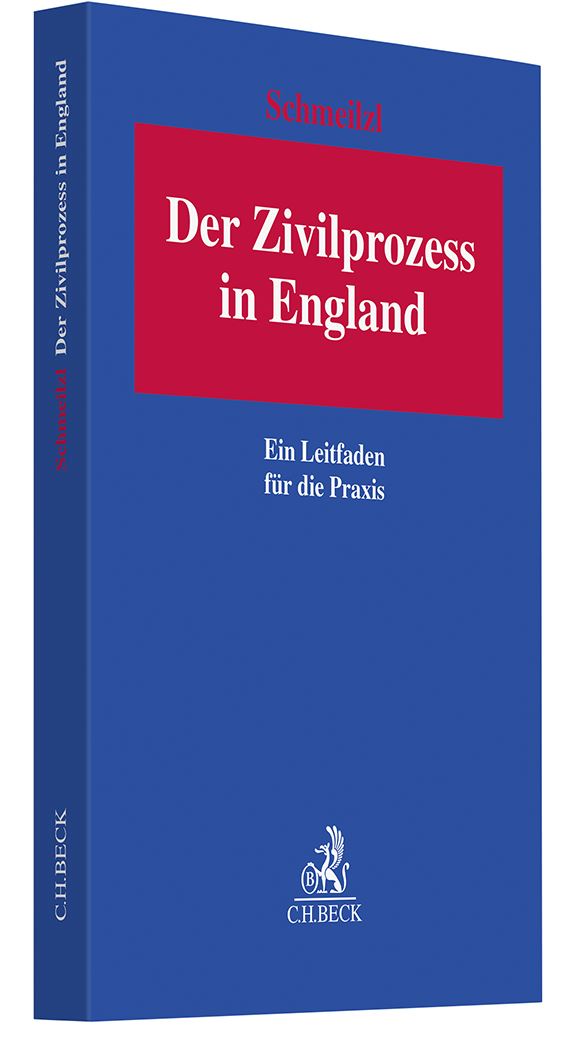Böse Überraschungen bei Rechtswahlklauseln in Verträgen mit ausländischen Geschäftspartnern
Ein ziemlich sicheres Mittel, deutsche Firmenchefs und ihre Inhouse-Lawyer aus der Fassung zu bringen, ist aus meiner Erfahrung Part 31 der englischen ZPO mit den dazugehörigen Practice Directions (Praxisrichtlinien). Jedenfalls wenn das Unternehmen Verträge mit ausländischen Geschäftspartnern hat, in denen englisches Recht vereinbart wurde. Und das ist im internationalen Geschäftsleben nicht selten. Selbst in Konstellationen, bei denen keine der Vertragsparteien selbst seinen Sitz in England hat, einigen sich die Parteien oft auf englisches Recht als „Kompromiss“.
Auswirkungen der Wahl des englischen Rechts ist oft gar nicht bekannt
Kommt es dann später zwischen den Geschäftspartnern zum Streit, frägt der deutsche Unternehmer englische Prozessanwälte, wie man den Anspruch denn nun in England gerichtlich durchsetzt.
Im etwa 10-seitigen „client information letter for commercial litigation“ der englischen Kanzlei liest er dann viele verblüffende Dinge, zum Beispiel dass sein Unternehmen vor dem englischen High Court komplett gläsern zu sein hat.
Die englische ZPO verlangt nämlich, dass jede Partei der Gegenseite alles (!) proaktiv offen legen muss, was auch nur irgendwie mit dem Rechtsstreit zu tun haben kann. Und zwar bereits vor Klageerhebung, Stichwort pre-action protocol.
Der Spaß heißt: DISCLOSURE!
Heutzutage bei internationalen Wirtschaftsprozessen (commercial litigation) auch gerne in der verschärften Form der sog. eDisclosure!
Alles, was Fallrelevanz haben kann, wird elektronisch erfasst und ausgetauscht oder in einen Datenraum gesteckt. Da fühlt sich der deutsche Unternehmer wie eine US-Behörde, die gerade Besuch von Elon Musks D.O.G.E.-Truppe bekommt.
Sinn der Offenlegungspflicht des englischen Zivilprozessrechts: Die Parteien eines Gerichtsverfahrens in England sollen Schwachpunkte des eigenen Anspruchs oder der eigenen Verteidigung gerade NICHT vor dem Prozessgegner verstecken können. Ziel eines englischen Zivilprozesses ist nämlich eine objektiv gerechte Entscheidung. Beweisnot einer Partei ist unerwünscht und wegen des Pflicht zur Disclosure in England auch selten.
Deutsche Unternehmer sowie deren Rechtsabteilungen unterschätzen diese praktischen Auswirkungen einer Gerichtsstands- und Rechtswahlklausel in Verträgen mit internationalen Geschäftspartnern meist immens.
Es macht halt einen gravierenden Unterschied, ob ich dem Gegner jede interne E-Mail meiner eigenen Mitarbeiter, jede Aktennotiz, jedes technische Messprotokoll zur verkauften Industrieanlage oder alle Einträge im Laborbuch proaktiv offen legen muss, oder nicht.
So manche vom Inhaber oder vom Management eines deutschen Unternehmens in Erwägung gezogene Klage erledigt sich da schon bei der internen „litigation due diligence“ und einem Beratungsgespräch mit der englischen Kanzlei.
Und für die Prozesse, die trotzdem geführt werden, generiert allein diese disclosure immense Kosten.
Ein ausführlicher Beitrag auf dem Blog www.EnglischesRecht.de führt ganz konkret vor Augen, was diese Offenlegungspflicht in der forensischen Praxis bedeutet. Mit Beispiel eines typischen Mandanten-Informationsbriefs zum Thema Offenlegungspflicht im englischen Zivilprozess:
Rechtsanwalt Bernhard Schmeilzl ist Experte für deutsch-englische Zivilverfahren und Wirtschaftsprozesse. Beim C.H. Beck Verlag veröffentlichte er das Praxishandbuch „Der Zivilprozess in England“ sowie den Länderbericht „Familienrecht in England und Wales“ im Nomos BGB-Kommentar.